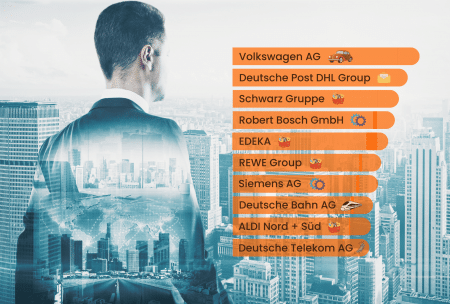Kranke Mitarbeiter kosten Geld. Viel Geld. 82 Milliarden Euro mussten deutsche Arbeitgeber im Jahr 2024 für die Lohnfortzahlung aufbringen. Diese Summe setzt sich aus 69,1 Milliarden Euro Bruttolohnfortzahlung und zusätzlichen 13 Milliarden Euro Sozialversicherungsbeiträgen zusammen, die Unternehmen auch während der Krankheit ihrer Mitarbeiter entrichten mussten.
Das entspricht dem Vierfachen dessen, was die gesetzlichen Krankenkassen für Krankengeld zahlten – und rund einem Viertel aller Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung. Trotzdem bleibt diese Belastung in der öffentlichen Debatte weitgehend unsichtbar.
Lohnfortzahlung als unternehmerisches Risiko
Sobald ein Arbeitnehmer krank ist, greift das Entgeltfortzahlungsgesetz. Es verpflichtet den Arbeitgeber, das volle Gehalt bis zu sechs Wochen weiterzuzahlen – unabhängig davon, ob das Unternehmen bereits ab dem ersten oder erst ab dem dritten Krankheitstag ein Attest verlangt. Erst danach übernimmt die Krankenkasse das reduzierte Krankengeld.
Was als soziale Errungenschaft gedacht war, hat sich für Unternehmen zu einem erheblichen Kostenfaktor entwickelt. Eine Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt: Die nominalen Aufwendungen für Entgeltfortzahlung sind seit 2010 um das 2,2-Fache gestiegen. Und es sind nicht nur mehr Krankheitsfälle, die die Kosten treiben.
Warum die Zahlen steigen – selbst ohne mehr Krankheit
Der Krankenstand in Deutschland ist seit rund zwei Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen. Ein Teil des Anstiegs erklärt sich durch den demografischen Wandel. Ältere Beschäftigte sind anfälliger für Erkrankungen wie Muskel- und Skeletterkrankungen, die häufig längere Ausfallzeiten verursachen. Gleichzeitig nehmen psychische Erkrankungen zu, deren Genesung deutlich mehr Zeit erfordert, obwohl sie noch unter fünf Prozent aller Fälle ausmachen.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Auch Atemwegserkrankungen sorgen regelmäßig für Ausfälle, besonders in den Herbst- und Wintermonaten. Auffällig: Jüngere Beschäftigte zeigen hier eine überdurchschnittlich hohe Krankheitslast. Seit 2022 werden Krankmeldungen zudem digital erfasst. Was früher teilweise statistisch nicht auftauchte, wird nun lückenlos dokumentiert. Selbst nach Bereinigung bleibt der Krankenstand auf hohem Niveau.
Doch selbst ohne einen Anstieg der Krankentage wären die Kosten gestiegen. Denn mit jeder Lohnerhöhung erhöht sich auch die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall – und bei steigender Beschäftigtenzahl haben mehr Arbeitnehmer Anspruch auf diese Leistung.
Die Last liegt beim Arbeitgeber – unabhängig von der Ursache
In Debatten wird häufig auf die Verantwortung der Betriebe verwiesen: bessere Arbeitsbedingungen, mehr Gesundheitsprävention, weniger Ausfälle. Doch viele Unternehmen haben längst investiert – in betriebliches Gesundheitsmanagement, in Ergonomie, in Prävention. Gleichzeitig können kleinere Betriebe solche Maßnahmen oft nicht stemmen.
Entscheidend ist: Die Ursache der Krankheit spielt im System keine Rolle. Auch wenn eine Erkrankung im privaten Umfeld oder durch Fremdeinwirkung entsteht, trägt der Arbeitgeber die Kosten. Die gesetzliche Unfallversicherung greift nur bei arbeitsbedingten Schäden – alles andere bleibt am Betrieb hängen.
Reformvorschläge liegen auf dem Tisch
Angesichts der wachsenden Belastung werden verschiedene Reformansätze diskutiert. Eine Option: sogenannte Karenztage, bei denen der Lohn für die ersten Krankheitstage entfällt oder gekürzt wird – ähnlich wie beim Krankengeld. Alternativ könnte die Lohnfortzahlung im Kalenderjahr begrenzt werden – auf maximal sechs Wochen, auch wenn mehrere Diagnosen vorliegen.
Wer schützt eigentlich die Arbeitgeber?
Die Frage ist deshalb nicht, ob Arbeitgeber zu wenig tun, sondern ob sie zu viel allein schultern. Denn während die Sozialversicherungen für jede Reform politische Rückendeckung erhalten, tragen Unternehmen die steigenden Lohnnebenkosten weitgehend ohne Schutzmechanismus.