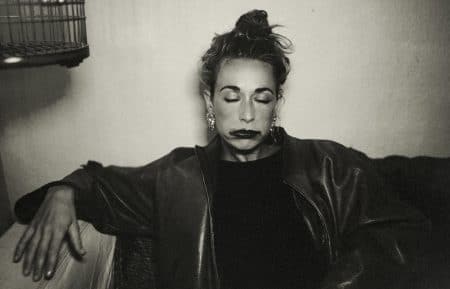Früher sagten Eltern und Großeltern: Lern was Ordentliches, dann bist du beruflich ein Leben lang abgesichert. Verwaltung, Buchhaltung, Assistenz – solide Büroarbeit eben. Heute ist klar: Genau diese Jobs sind als Erste weg. Künstliche Intelligenz erledigt sie schneller, präziser und braucht keine Pause. Wer heute noch Routineaufgaben am Bildschirm löst, könnte bald von einem Algorithmus ersetzt werden.
Was bedeutet Automatisierung für klassische Bürojobs?
Laut dem Future of Jobs Report 2025 des Weltwirtschaftsforums gehen 93 Prozent der deutschen Unternehmen davon aus, dass sich ihre Geschäftsmodelle durch KI und digitale Informationsverarbeitung bis 2030 grundlegend verändern werden. Der Umbruch ist also keine ferne Vision, sondern Fakt.
Welche Berufe sind besonders gefährdet?
Besonders betroffen sind Jobs mit hohem Wiederholungsanteil: Sachbearbeitung, Kundendienst, klassische Assistenz oder Bank- und Versicherungstätigkeiten. Alles, was nach festen Regeln abläuft, kann automatisiert werden. Chatbots beantworten Kundenanfragen, Self-Service-Portale ersetzen den menschlichen Kontakt, KI-Systeme erfassen Daten oder prüfen Rechnungen – und zwar rund um die Uhr.
Die Automatisierung frisst sich tief in die deutschen Büros. Doch der große Knall blieb aber bislang aus. Stattdessen verläuft die Entwicklung eher schleichend. Bestimmte Aufgaben und Tätigkeitsfelder verschwinden nach und nach. Stellen werden nicht neu nachbesetzt. Viele Mitarbeitende merken erst spät, dass ihr Arbeitsplatz längst ins Visier der Maschinen geraten ist und ihre Rolle zunehmend überflüssig wird.
Weiterbildung als Rettungsanker? Nicht für alle
Laut WEF-Prognose sehen deutsche Unternehmen bei etwa der Hälfte ihrer Belegschaft Trainingsbedarf bis 2030. 29 Prozent sollen in ihrer aktuellen Rolle weiterqualifiziert, weitere 20 Prozent auf neue Aufgaben umgeschult werden. Gleichzeitig erwarten viele Firmen, dass sich ein Drittel der Kernkompetenzen in den nächsten Jahren komplett verändert. Was gestern noch gefragt war, ist morgen wertlos.
Besorgniserregend: Rund elf Prozent der Beschäftigten sollen laut Studie gar keine Weiterbildung erhalten – obwohl ihre heutigen Fähigkeiten bald nicht mehr gebraucht werden. Diese Menschen drohen aus dem qualifizierten Arbeitsmarkt zu fallen. Mit allen bekannten Folgen: finanzielle Unsicherheit, berufliche Perspektivlosigkeit, sozialer Abstieg.
Unternehmen reden viel – und tun (noch) zu wenig
Dabei ist das Problembewusstsein auf Arbeitgeberseite vorhanden. 85 Prozent der Unternehmen weltweit planen, ihre Mitarbeitenden gezielt weiterzubilden. In Deutschland ist die Bereitschaft ähnlich hoch. Doch der Wille allein reicht natürlich nicht. Nur etwa die Hälfte der Beschäftigten hat bisher tatsächlich an Trainings teilgenommen. Besonders kleine und mittlere Betriebe scheitern oft an fehlendem Budget, mangelnder Strategie oder schlicht an der eigenen Trägheit.
Das Paradoxe: Unternehmen wissen, dass ihnen ohne neue Kompetenzen die Fachkräfte fehlen werden. Trotzdem handeln viele zu zögerlich. Wer jetzt nicht investiert, verliert nicht nur Wissen, sondern auch Anschlussfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit.
Welche Skills jetzt wirklich zählen
Für die betroffenen Mitarbeitenden heißt das: Anpassungsfähigkeit reicht nicht mehr. Wer in einem bedrohten Job arbeitet, braucht konkrete Perspektiven. Weiterbildung ist keine Option, sondern Notwendigkeit. Und zwar nicht in Form von Zeitmanagement-Workshops oder Mindset-Seminaren, sondern als Qualifizierung für eine digitalisierte Arbeitswelt.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Gefragt sind analytisches Denken, technologische Grundkenntnisse, Datenkompetenz, Prozessanalyse und Kreativität. Es geht nicht darum, dass alle LLMs-Nerds werden. Aber jede und jeder sollte verstehen, wie Technologie den eigenen Job beeinflusst – und wie man diesen Wandel aktiv mitgestaltet.
Die Automatisierung kommt nicht. Sie ist längst da. Und sie verändert alles, was wir die letzten jahrnzehnte jobmäßig gewohnt waren. Wer also heute nichts tut, verliert morgen seinen Job.