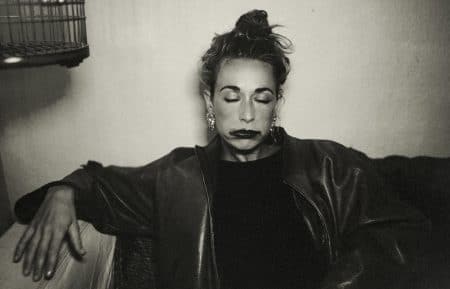Die Wirtschaft ächzt unter dem Fachkräftemangel. In nahezu allen Branchen fehlen qualifizierte Arbeitskräfte – von Pflege über Handwerk bis hin zur IT. Gleichzeitig zeigt eine aktuelle Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB): Immer mehr junge Erwerbstätige in Deutschland haben keinen Berufsabschluss.
Zwischen 2013 und 2024 stieg die Zahl der 20- bis 34-jährigen Erwerbspersonen ohne formale berufliche Qualifikation um fast eine halbe Million. Der Anteil dieser sogenannten nicht formal Qualifizierten (nfQ) innerhalb dieser Altersgruppe kletterte von 9,9 auf 13 Prozent. Das heißt: Jeder achte junge Erwerbstätige hat keine abgeschlossene Ausbildung.
Fachkräftemangel – aber Ausbildung kein Muss?
Die Diskrepanz könnte größer kaum sein. Denn laut IAB erfordern inzwischen über drei Viertel aller offenen Stellen in Deutschland eine abgeschlossene Berufsausbildung. Ohne formalen Abschluss bleiben vielen jungen Menschen nur Helferjobs – niedrig bezahlt, wenig sicher, perspektivlos.
Gleichzeitig liegt die Arbeitslosenquote unter den nfQ bei über 20 Prozent – mehr als dreimal so hoch wie im Durchschnitt. Wer keinen Berufsabschluss hat, hat also nicht nur schlechtere Chancen, überhaupt einen Job zu finden. Sondern wird auch bei wirtschaftlichen Verwerfungen oder strukturellen Umbrüchen zuerst verdrängt. Und trotzdem steigt der Anteil der Menschen ohne Ausbildung. Warum?
Ursachenforschung: Demografie trifft Systemschwäche
Ein Teil der Erklärung liegt in der veränderten Zusammensetzung der Erwerbsbevölkerung. Die Zuwanderung der vergangenen Jahre hat die demografische Struktur verschoben – insbesondere durch Menschen aus Ländern mit vergleichsweise niedrigeren Ausbildungsquoten. Unter jungen Erwerbspersonen aus sogenannten Asylherkunftsländern liegt der nfQ-Anteil bei rund 45 Prozent.
Doch die Erklärung greift zu kurz. Denn auch bei Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit ist die Quote gestiegen – wenn auch nur leicht, von 8,5 auf 9,6 Prozent.
Das legt nahe: Es geht nicht nur um Herkunft, sondern auch um System. Steigende Ausbildungsabbrüche, überforderte Berufsschulen, fehlende Unterstützungsangebote für lernschwächere Jugendliche – all das sind strukturelle Probleme, die längst auch das deutsche Bildungssystem betreffen.
Die Gefahr: Eine stille Verdrängung aus der Mitte
Was kurzfristig nach einer individuellen Entscheidung aussieht – keine Ausbildung, irgendein Job, Geld verdienen – wird langfristig zum Problem. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Gesellschaft insgesamt.
Denn in einer alternden Bevölkerung wird jeder fehlende Berufsabschluss doppelt spürbar.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
- Für Unternehmen bedeutet er: Eine Stelle bleibt unbesetzt.
- Für die Sozialkassen: Ein höheres Risiko auf Arbeitslosigkeit und spätere Altersarmut.
- Für die Demokratie: Ein wachsender Anteil der Bevölkerung mit geringer Teilhabe und begrenzten Aufstiegschancen.
Und während die Zahl der Studierenden über Jahre zugenommen hat, ist der Ausbildungsmarkt „ausgetrocknet“, wie es das IAB formuliert. Die Kluft zwischen akademischer Bildung und beruflicher Qualifikation wächst – auf Kosten der Mitte.
Was jetzt passieren muss
Der Handlungsauftrag ist klar: Alle Potenziale müssen gehoben werden. Niemand sollte das Bildungssystem ohne Abschluss verlassen – und erst recht nicht dauerhaft im prekären Beschäftigungssegment verbleiben.
Was das heißt:
- Bessere Berufsberatung: Individuell, niedrigschwellig, lebensnah. Nicht nur am Ende der Schulzeit, sondern frühzeitig und wiederholt.
- Mehr Durchlässigkeit: Wer abbricht, darf nicht rausfallen. Modularisierte Ausbildungswege, berufsbegleitende Abschlüsse und Qualifizierungen bieten Alternativen.
- Gezielte Unterstützung für Zugewanderte: Sprachkurse, Anerkennungsverfahren, Qualifizierungsmaßnahmen müssen schneller, verbindlicher und praxisnäher werden.
- Stärkere Rolle der Betriebe: Wer ausbildet, muss sich kümmern – gerade auch um Jugendliche mit Förderbedarf. Es braucht Ressourcen, Konzepte und Haltung.
- Klare Signale vom Staat: Eine Ausbildungsgarantie allein reicht nicht. Es braucht eine echte Verzahnung von Schule, Arbeitsmarkt und sozialer Unterstützung.
Ein verlorenes Jahrzehnt – oder der Wendepunkt?
Die Entwicklung der letzten zehn Jahre ist alarmierend – aber nicht irreversibel. Wer heute ohne Abschluss ist, kann morgen qualifiziert sein. Aber das passiert nicht von allein. Es braucht gezielte Impulse und koordinierte Anstrengungen – von Schulen, Betrieben, Politik und Zivilgesellschaft.
Denn: Ohne formale Qualifikation wird der Arbeitsmarkt der Zukunft zur Einbahnstraße.
Und ohne ausreichend qualifizierte Fachkräfte wird der Wohlstand in Deutschland zur Illusion.