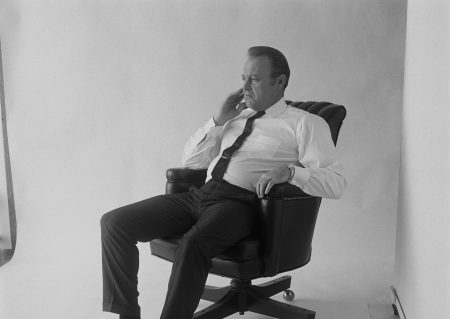Nur ein Bruchteil der Change-Projekte in Unternehmen gelingt. Woran das liegt? Oftmals an den Vorgesetzten – besonders dann, wenn sie es versäumen, sich selbst zu verändern. Häufig sind es die Führungskräfte, die starr, überfordert oder schlicht nicht bereit sind, sich auf Neues einzulassen. Die Folge: Veränderungen scheitern, Frust breitet sich aus – und die Mitarbeiter bleiben auf der Strecke.
Alte Muster, neue Herausforderungen: Warum Führung scheitert
Führung in Zeiten des Wandels ist nicht nur eine Herausforderung, sie ist eine paradoxe Hürde. Diejenigen, die Veränderungen anstoßen sollen, sind oft selbst die größten Verhinderer. Sie sollen für Offenheit, Agilität und Zukunftsorientierung stehen – und sind gleichzeitig nicht selten tief verwurzelt in alten, bewährten Denk- und Handlungsmustern.
Das Problem dabei: Gute Führung wäre genau das Gegenteil. Es wäre die Fähigkeit, flexibel zu sein, den Spagat zwischen Kontrolle und Vertrauen zu schaffen und das eigene Verhalten schonungslos zu reflektieren. Doch viele Führungskräfte scheitern an dieser Anforderung.
Veränderung heißt Unsicherheit – und Unsicherheit heißt Kontrollverlust
Genau diesen Kontrollverlust versuchen viele Führungskräfte zu vermeiden, indem sie starr an alten Methoden und Strukturen festhalten, Mikro-Management betreiben oder die eigenen Mitarbeiter nicht ausreichend an Entscheidungsprozessen beteiligen. Das Ergebnis: Die anvisierte Veränderung bleibt an der Oberfläche, während das Team in einem Meer aus widersprüchlichen Anweisungen, falschen Versprechungen und mangelnder Unterstützung zu ertrinken droht.
Führungskräfte als größte Bremse
Eine der größten Herausforderungen für Führungskräfte in Change-Prozessen besteht darin, nicht selbst zu einem Hindernis zu werden. Denn der Wandel verlangt nicht nur nach neuen Methoden und Prozessen, sondern in erster Linie nach einer neuen Haltung. Wer als Führungskraft nicht bereit ist, die eigene Komfortzone zu verlassen, die eigene Position zu hinterfragen und echte Beteiligung zuzulassen, wird mit hoher Wahrscheinlichkeit scheitern. Nicht die Mitarbeiter sind es, die den Wandel verhindern – es sind die Führungskräfte selbst, die die notwendige Transformation blockieren.
Führungskultur als Ursache für das Scheitern von Change-Projekten
Ein großes Problem ist dabei die Führungskultur, die in vielen Unternehmen vorherrscht. Oft wird Führung noch immer mit Kontrolle und Dominanz gleichgesetzt. Das äußert sich in einem Verhalten, das wenig Raum für Vertrauen und Eigenverantwortung lässt. Mitarbeiter sollen Verantwortung übernehmen, doch gleichzeitig wird jede Entscheidung überprüft und kontrolliert. Sie sollen innovativ sein, doch jede Abweichung von der Norm wird kritisiert. Diese Führungskultur sorgt dafür, dass Mitarbeiter irgendwann einfach aufhören, sich einzubringen. Sie tun nur noch das Nötigste, um Konflikte zu vermeiden und übersehen zu werden.
Studienergebnisse: Warum so viele Change-Projekte scheitern
Laut der Porsche Consulting Change Management Compass 2023 Studie scheitern 69 % der Transformationsprojekte aufgrund unzureichenden Change Managements. Die Studie zeigt, dass erfolgreiche CEOs Veränderungen aktiv vorantreiben: 81 % der CEOs in erfolgreichen Unternehmen nehmen aktiv am Change Management teil, im Vergleich zu nur 25 % in erfolglosen Transformationen. Dies verdeutlicht, wie wichtig es ist, dass Führungskräfte nicht nur Veränderungen anstoßen, sondern sie aktiv begleiten und als Vorbild agieren.
Über die Hälfte der deutschen mittleren Führungskräfte zeigt immer noch nicht die nötige Bereitschaft, notwendige Veränderungen umzusetzen, was oft zum Scheitern der Transformation führt. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie entscheidend eine engagierte und fähige Führungsebene für den Erfolg von Wandel ist.
Folgen für die Mitarbeiter: Resignation und Burnout
Die Folgen für die betroffenen Mitarbeiter sind verheerend. Wer ständig zwischen widersprüchlichen Anforderungen hin- und hergerissen ist, verliert irgendwann die Motivation und den Glauben daran, wirklich etwas bewirken zu können. Das resultiert in innerer Kündigung, Resignation und im schlimmsten Fall in emotionaler und körperlicher Erschöpfung bis hin zum Burnout.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Denn die ständige Unsicherheit, die fehlende Orientierung und der Druck, das Unmögliche leisten zu müssen, hinterlassen ihre Spuren. Mitarbeiter werden antriebslos, gestresst und emotional ausgelaugt. Die Energie, die eigentlich für den Wandel benötigt wäre, verpufft im Versuch, den widersprüchlichen Erwartungen der Führung zu genügen.
Das 3-Phasen-Modell nach Lewin: Veränderungen richtig gestalten
Um Veränderungen erfolgreich zu gestalten, kann das 3-Phasen-Modell nach Kurt Lewin eine wichtige Orientierung bieten. Das Modell wurde in den 1940er Jahren von dem Psychologen Kurt Lewin entwickelt und beschreibt drei Phasen, die für einen gelungenen Wandel notwendig sind: „Auftauen“ (Unfreeze), „Verändern“ (Change) und „Einfrieren“ (Refreeze).
-
Auftauen (Unfreeze): In dieser Phase geht es darum, das bestehende System aufzubrechen und die Bereitschaft für Veränderungen zu schaffen. Führungskräfte müssen die Notwendigkeit des Wandels klar kommunizieren und eine Dringlichkeit erzeugen, damit Mitarbeiter verstehen, warum eine Veränderung notwendig ist. Hierbei spielt auch die Selbstreflexion der Führungskräfte eine entscheidende Rolle: Sie müssen sich selbst hinterfragen und die eigenen Denkmuster loslassen, um Veränderung zu ermöglichen.
-
Verändern (Change): Nachdem die Bereitschaft für den Wandel geschaffen wurde, beginnt die eigentliche Veränderung. In dieser Phase werden neue Prozesse, Strukturen und Verhaltensweisen eingeführt. Führungskräfte müssen in dieser Phase als Vorbilder agieren, ihre Mitarbeiter unterstützen und aktiv in den Veränderungsprozess einbinden. Transparente Kommunikation und das Zulassen von Fehlern sind entscheidend, damit Mitarbeiter sich sicher fühlen und den Wandel mittragen.
-
Einfrieren (Refreeze): In der letzten Phase geht es darum, die neuen Prozesse und Strukturen zu stabilisieren. Die Veränderungen müssen in den Arbeitsalltag integriert und gefestigt werden, damit sie langfristig bestehen bleiben. Führungskräfte sollten sicherstellen, dass die neuen Verhaltensweisen zur Normalität werden und Erfolgserlebnisse gefeiert werden, um die Motivation der Mitarbeiter aufrechtzuerhalten.
Mit dem 3-Phasen-Modell nach Lewin können Führungskräfte den Wandel strukturieren und gezielt anstoßen. Wichtig ist, dass sie die Veränderung nicht nur verordnen, sondern aktiv begleiten und selbst als Teil des Wandels agieren. Nur wenn Führungskräfte bereit sind, den Veränderungsprozess selbst vorzuleben, kann der Wandel erfolgreich gelingen.
Der Weg aus der Sackgasse: Veränderung durch Selbstreflexion
Damit Veränderungen gelingen können, braucht es Führungskräfte, die auch bereit sind, sich selbst zu verändern. Die bereit sind, die eigenen Verhaltensmuster zu reflektieren und sich von der Vorstellung zu verabschieden, alles kontrollieren zu können. Es braucht eine Führungskultur, die auf Vertrauen, Offenheit und Beteiligung setzt. Mitarbeiter müssen als Partner im Wandel verstanden werden – nicht als Befehlsempfänger, die Anweisungen ohne zu hinterfragen ausführen.
Praktische Empfehlungen für Führungskräfte
Um ihre Change-Management-Kompetenzen zu verbessern und den Wandel erfolgreich zu gestalten, sollten Führungskräfte folgende Schritte in Betracht ziehen:
-
Führungskräftetraining und Coaching: Führungskräfte sollten regelmäßig an Schulungen und Coachings teilnehmen, um ihre Fähigkeiten im Change Management zu verbessern. Dabei geht es nicht nur um technische Fähigkeiten, sondern auch um Soft Skills wie Kommunikation, Empathie und Konfliktlösung.
-
Selbstreflexion fördern: Führungskräfte sollten regelmäßig Zeit für Selbstreflexion einplanen, um ihr eigenes Verhalten kritisch zu hinterfragen. Tools wie Tagebücher, Peer-Feedback oder professionelle Coaching-Sitzungen können dabei helfen, blinde Flecken zu identifizieren und Verbesserungsmöglichkeiten zu erkennen.
-
Mitarbeiter aktiv einbinden: Veränderung gelingt nur, wenn Mitarbeiter aktiv in den Prozess eingebunden werden. Führungskräfte sollten sicherstellen, dass sie regelmäßig Feedback von ihren Teams einholen, gemeinsam Ziele definieren und den Mitarbeitern ausreichend Entscheidungsfreiheit lassen. Dies fördert das Vertrauen und die Akzeptanz im Team.
-
Fehler zulassen und Lernen fördern: Wandel bringt zwangsläufig Unsicherheit und Fehler mit sich. Führungskräfte sollten eine Kultur des Lernens etablieren, in der Fehler als Chancen zur Verbesserung gesehen werden. Dies erfordert, dass Führungskräfte selbst offen über eigene Fehler sprechen und den Mitarbeitern die Angst nehmen, etwas falsch zu machen.
-
Klare Vision und Kommunikation: Eine klare Vision, wohin die Veränderung führen soll, ist entscheidend. Führungskräfte sollten diese Vision regelmäßig kommunizieren und sicherstellen, dass alle Mitarbeiter verstehen, warum der Wandel notwendig ist. Dies schafft Orientierung und Motivation.
Unternehmen, die echte Veränderungen anstoßen wollen, müssen ihre Führungskräfte dazu befähigen, ihre Rolle als Gestalter und Wegbegleiter zu verstehen – nicht als Kontrolleure. Es braucht Raum für Experimente, für Fehler und für das gemeinsame Lernen. Nur so kann aus einem starren System ein flexibles und agiles Unternehmen werden, das den Herausforderungen der Zukunft gewachsen ist.