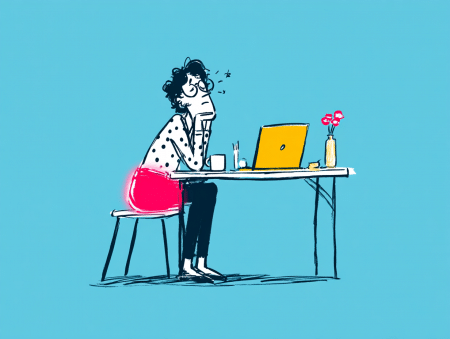Du arbeitest hart. Der Tag zieht sich endlos, der Kopf ist leer, die Hände mechanisch, die Konzentration längst dahin. Und dann passiert es. Ein Fehler, ein Moment der Unachtsamkeit, ein Unfall – ausgelöst von nichts anderem als Erschöpfung.
In vielen deutschen Betrieben ist das längst kein fiktives Szenario mehr, sondern Alltag. Der Fachkräftemangel hat eine Lücke gerissen, die vielerorts nicht mehr durch Neueinstellungen gefüllt werden kann. Also verteilen Arbeitgeber die Arbeit auf jene, die noch da sind. Mehr Überstunden, längere Schichten, weniger Pausen. Eine stille Erschöpfung frisst sich durch die Belegschaften. Wer nicht mehr kann, fällt aus – und die, die bleiben, müssen noch mehr leisten.
Mehr Stunden, mehr Leistung? Ein gefährlicher Irrtum
Was logisch klingt, ist in Wahrheit ein Trugschluss. Längere Arbeitszeiten bedeuten nicht automatisch mehr Produktivität. Nach Einschätzung von Arbeitszeitforschern steigen bei längeren Arbeitszeiten die psychischen und körperlichen Belastungen deutlich – gleichzeitig sinken Leistung und Konzentration. Die Folge: Ausfälle durch Unfälle oder stressbedingte Erkrankungen nehmen zu, und die Belastung für die verbleibenden Beschäftigten wächst weiter.
Es geht nicht nur um Zahlen. Es geht um Menschen. Um die Pflegekraft, die nach endlosen Schichten den Überblick verliert. Um den Maschinenführer, der in der letzten Überstunde den falschen Knopf drückt. Um den Lkw-Fahrer, der am Steuer nach zu langer Lenkzeit kurz einnickt.
Viele Arbeitgeber sehen nur die geleisteten Stunden ihrer Beschäftigten, aber nicht, was dieses Arbeitspensum mit den Menschen macht. Dabei ist ein „Mehr“ an Arbeit nicht gleichbedeutend mit mehr Produktivität – oft bewirkt sie sogar das Gegenteil.
Mit Folgen für die Gesundheit
Die Folgen zeigen sich schleichend. Müde Menschen machen nicht nur mehr Fehler, sie werden auch häufiger krank. Schlafstörungen, Depressionen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen – die Liste der Belastungen ist lang. Laut WHO und ILO starben 2016 weltweit rund 745.000 Menschen an den Folgen langer Arbeitszeiten. Besonders betroffen: Menschen, die regelmäßig 55 Stunden oder mehr pro Woche arbeiten. Ihr Risiko für Schlaganfälle steigt um 35 Prozent, das für tödliche Herzkrankheiten um 17 Prozent – verglichen mit einer normalen 40-Stunden-Woche.
Für Unternehmen hat das gravierende Folgen: Jeder Ausfall belastet die verbleibenden Teams zusätzlich. Eine Spirale aus Überarbeitung, Krankheit und Personalmangel, die sich immer weiterdreht – bis irgendwann nichts mehr geht.
Fachkräftemangel durch Mehrarbeit lösen?
Während einige Branchen über eine Verlängerung der Lebensarbeitszeit oder eine Ausweitung der Wochenarbeitszeit diskutieren, zeigen die Daten längst eine andere Richtung. Laut Destatis arbeiteten Vollzeiterwerbstätige in der EU 40,4 Stunden pro Jahr. Deutschland lag mit 40,3 und Finnland mit 38,9 Stunden leicht darunter. Warum sind kürzere Arbeitszeiten sinnvoll? Weil ausgeruhte Menschen besser arbeiten. Weil weniger Krankenstände den Betrieb stabilisieren. Weil zufriedene Beschäftigte bleiben – und nicht kündigen.
Wer dauerhaft also über seine Grenzen geht, brennt aus und verschleißt. Und verlässt am Ende den Arbeitsmarkt – entweder durch Krankheit oder freiwillig, weil Vereinbarkeit und Lebensqualität auf der Strecke bleiben.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Lösungsansätze: Was tun?
Was also tun in Zeiten, in denen Fachkräfte fehlen, Aufträge wachsen und die Belegschaften altern? Die Antwort ist nicht neu, aber sie wird viel zu selten konsequent umgesetzt:
- Flexible Arbeitszeitmodelle, die Mitarbeitenden echte Wahlfreiheit geben – insbesondere Eltern oder älteren Beschäftigten.
- Gesundheitsschutz, der nicht als Pflichtübung in der Gefährdungsbeurteilung endet, sondern spürbar im Arbeitsalltag ankommt.
- Rückgewinnung von Fachkräften, die wegen schlechter Arbeitsbedingungen in Teilzeit geflüchtet oder ganz ausgestiegen sind – besonders in Bereichen wie Pflege oder Bildung.
- Qualifizierung von Menschen, die bislang am Arbeitsmarkt vorbeilaufen, etwa durch Weiterbildung und Umschulung.
Vielleicht braucht es dafür weniger Sonntagsreden über die angebliche „Faulheit“ oder „Motivationslosigkeit“ der Deutschen und mehr Investitionen in die Menschen, die das Rückgrat dieser Wirtschaft bilden. Nicht als billige Human Ressource, sondern als das, was sie sind: Menschen mit Grenzen. Menschen, die leistungsfähig sein wollen – wenn man sie lässt.
Ein System am Limit
Es ist paradox:
„Arbeitgeber, die glauben, den Fachkräftemangel mit Mehrarbeit lösen zu können, verschärfen ihn nur.“
Anzeige
Denn jede zusätzliche Stunde, die jemand über seine Kräfte geht, birgt das Risiko, dass bald jemand ganz ausfällt. Dass am Ende nicht nur der Einzelne leidet, sondern das gesamte System. Und damit die Gesellschaft, die auf gesunde, motivierte Arbeit mehr denn je angewiesen ist.
Vielleicht wäre das der Moment, umzudenken. Weg von der Formel „mehr Zeit gleich mehr Arbeit“. Hin zu der Erkenntnis, dass weniger manchmal mehr ist.