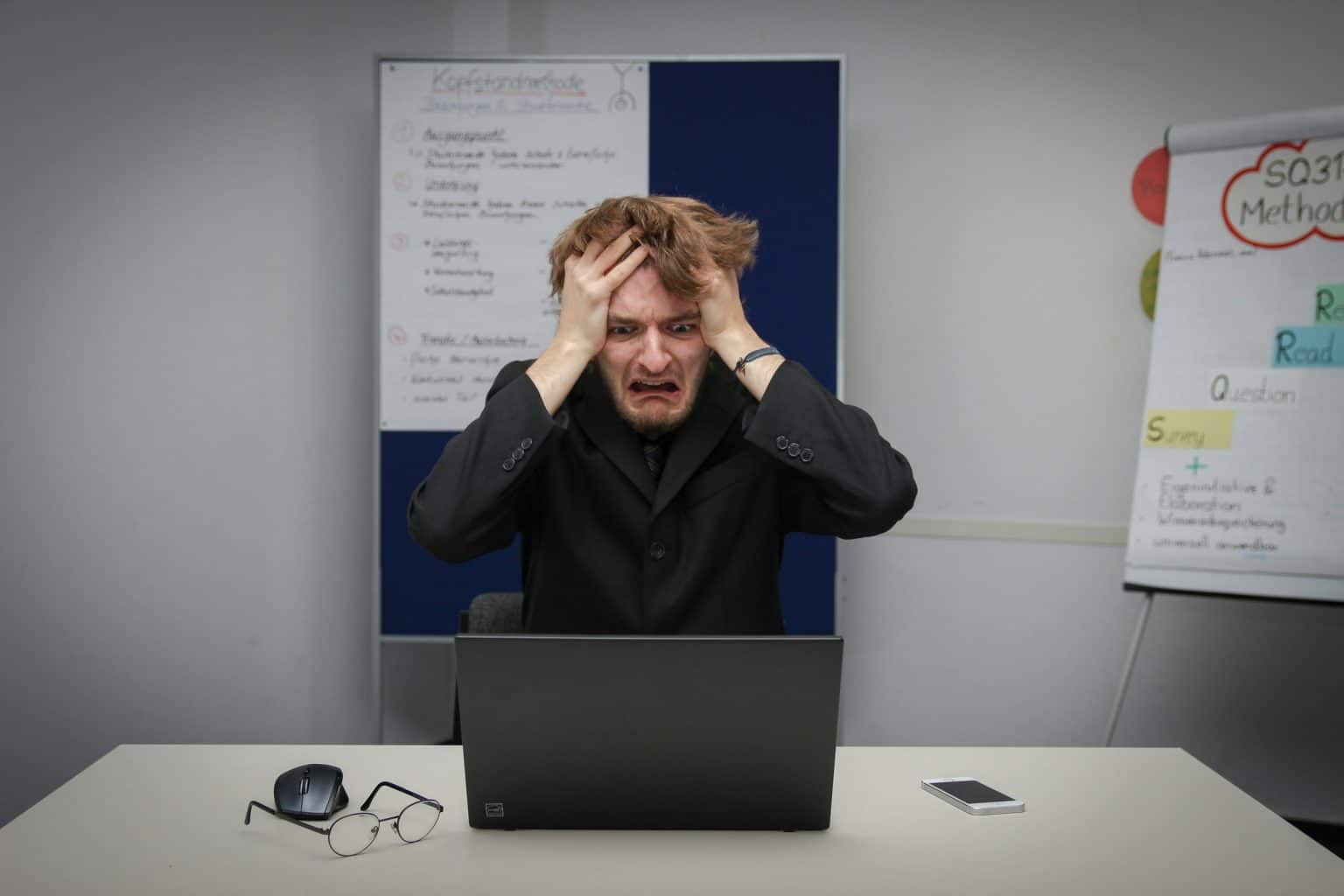Künstliche Intelligenz gehört für viele Beschäftigte längst zum Arbeitsalltag. E-Mails schreiben, Recherchen beschleunigen, Notizen zusammenfassen – vieles läuft inzwischen über Tools wie ChatGPT, Copilot oder ähnliche Assistenzsysteme. Die Hoffnung dahinter: weniger Aufwand, mehr Effizienz. Doch die Realität sieht dann doch anders aus.
Laut dem aktuellen „State of AI at Work“-Report nutzen im Gegensatz zu 2023 (36 %) inzwischen 70 Prozent der Wissensarbeiter wöchentlich KI-Tools. Gleichzeitig fühlen sich 84 Prozent digital erschöpft. Zahlen, die nicht zusammenpassen.
Mehr Technik, weniger Wirkung?
Was eigentlich entlasten sollte, scheint das Gegenteil zu bewirken. Der Bericht zeigt deutlich: In vielen Unternehmen wird Künstliche Intelligenz nicht als Instrument sinnvoller Arbeitsveränderung eingesetzt, sondern als Reaktion auf bestehende Überforderung.
Das Muster: Wenn etwas nicht funktioniert, wird ein weiteres Tool eingeführt. Erst Slack, dann Notion, jetzt KI. Die Versprechen sind groß, doch die Symptome verschwinden nicht. Sie verschieben sich nur.
Automatisiertes Chaos
Unübersichtliche Prozesse, unklare Verantwortlichkeiten, zu viele Schnittstellen – all das bleibt bestehen. Nur wird es jetzt digitalisiert. Der Report fasst es treffend zusammen:
„Unternehmen automatisieren das Chaos.“
55 Prozent ihrer Arbeitszeit verbringen Wissensarbeiter mit sogenannter „Busywork“ – also Aufgaben, die kaum einen merklichen Effekt auf die produktive Arbeit haben: Informationen zusammensuchen, Status-Updates nachjagen, Tools pflegen, Abstimmungen organisieren.
Künstliche Intelligenz wird in vielen Fällen nicht eingeführt, um Arbeit neu zu denken, sondern um Überforderung zu verwalten.
Doch solange nicht hinterfragt wird, was diese Arbeit überhaupt leisten soll, bleibt jede Automatisierung oberflächlich. Es geht nicht darum, veraltete Prozesse zu beschleunigen, sondern sie obsolet zu machen.
Zwei Klassen der KI-Nutzung
Die Studie unterscheidet zwischen zwei Gruppen: sogenannte „AI Scalers“ und „Nonscalers“. Erstere nutzen KI nicht nur punktuell, sondern gestalten ihre Arbeit aktiv um. Prozesse werden so aufgebaut, dass Mensch und Maschine sinnvoll zusammenspielen. Diese Unternehmen berichten von klaren Produktivitätsgewinnen, besserer Koordination und höherer Zufriedenheit.
Die „Nonscalers“ hingegen verharren im Experimentiermodus. Sie testen Tools, setzen Impulse – ohne jedoch grundlegende Strukturen zu verändern. Das Ergebnis: mehr Technologie, aber keine echte Transformation.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Das erklärt auch, warum nur wenige Unternehmen den Durchbruch schaffen: Die Zahl der „AI Scalers“ ist zwar von 7 % im Jahr 2024 auf 29 % im Jahr 2025 gestiegen – ein deutliches Signal für Fortschritt. Doch 71 % der Unternehmen stecken weiterhin in der Planungs- oder Pilotphase fest und scheitern daran, über Einzelanwendungen hinauszukommen.
Wenn Technik Orientierung ersetzt
Ein weiteres Problem: Die Einführung von KI geschieht in vielen Fällen ohne Strategie und ohne ausreichende Schulung. Natürlich ist das Thema Künstliche Intelligenz noch vergleichsweise jung – gerade deshalb braucht es klare Orientierung. Denn wo sie fehlt, entsteht Unsicherheit.
46 Prozent der Beschäftigten geben sogar an, ihre KI-Nutzung zu verschweigen, aus Sorge, als überfordert oder gar inkompetent im Umgang mit neuen Technologien zu gelten.
Die Verantwortung liegt klar bei der Führungsebene: Wer KI einführt, ohne Prozesse, Zuständigkeiten und Ziele klar zu definieren, löst keine Probleme – er verschiebt sie nur. Der Unterschied zeigt sich in der Herangehensweise: Während Nonscalers darauf hoffen, dass sich die Nutzung von KI irgendwie einspielt, begleiten AI Scalers ihre Beschäftigten durch strukturierte Transformationsprozesse und fördern gezielt KI-Kompetenzen auf allen Ebenen. Sie verstehen, dass technologische Transformation immer auch menschliche Transformation bedeutet.
Strukturlose Effizienz ist keine Lösung
Oft wirkt es so, als wäre KI die neue Hoffnungsträgerin für alles, was in Unternehmen schiefläuft. Doch das ist ein Trugschluss. Künstliche Intelligenz kann Informationen ordnen, Texte generieren, Muster erkennen – aber sie ersetzt keine klaren Entscheidungen. Sie kann keine Prioritäten setzen, keine Verantwortung übernehmen, keine Zielkonflikte auflösen.