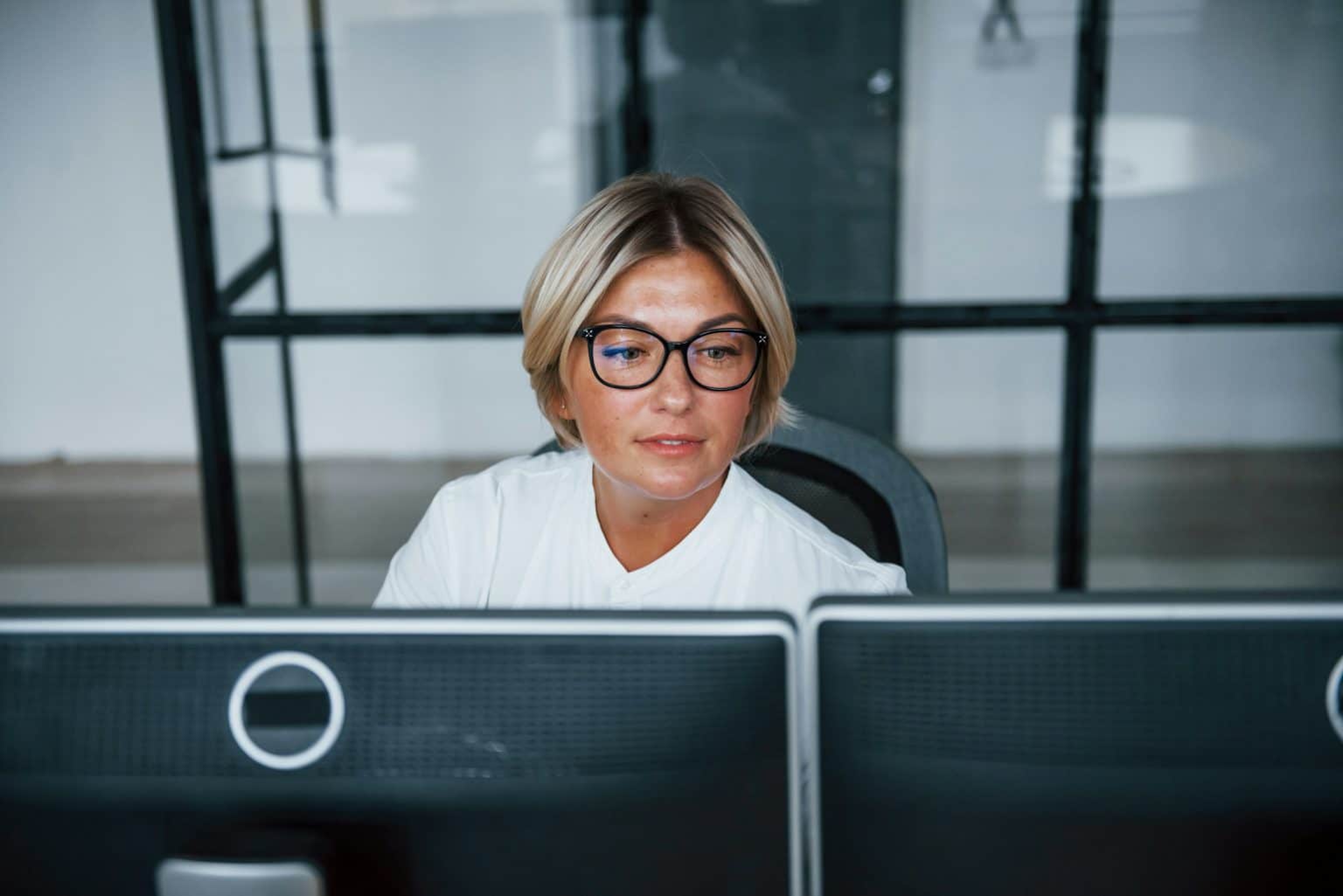„Ich liebe meinen Job“ – ein Satz, den viele wie ein Mantra vor sich herpredigen. Aber was, wenn diese Jobliebe nur Fassade ist? Eine Strategie, um sich nicht hinterfragen zu müssen, wie viel Sinn, Erfüllung oder Freude da wirklich noch steckt. Also sagen wir nichts. Und reden es uns die Arbeit schön.
Die große Illusion vom Traumjob
Das hat System. Wir loben die netten Kollegen, die drei Homeoffice-Tage im Monat, den gratis Kaffee während wir gleichzeitig innerlich immer häufiger das Gefühl haben, dass doch etwas fehlt. Die Herausforderung vielleicht. Oder die Perspektive. Vielleicht auch einfach nur das Gefühl, die eigene Karriere wirklich selbst zu gestalten. Aber Veränderung macht Angst. Deshalb bleiben wir lieber.
Psychologisch gesehen ist dieses Verhalten nicht ungewöhnlich. Der Fachbegriff lautet kognitive Dissonanz: Unser Gehirn erträgt keine inneren Widersprüche. Wer viel Zeit, Energie und persönliche Identität in eine Karriere gesteckt hat, möchte glauben, dass sich all das gelohnt hat. Zweifel daran würden den gesamten Lebensentwurf infrage stellen. Also sagen wir uns: „So schlimm ist es doch gar nicht.“
Warum wir im Job bleiben, obwohl wir gehen wollen
Gleichzeitig ist da der sozialer Druck, der die Schönfärberei weiter befeuert. Wer in Gesprächen offen über Frust oder innere Kündigung spricht, bekommt schnell gut gemeinte Ratschläge – oder Mitleid. Beides will niemand. Also ziehen wir die Maske auf, posten motivierte Büro-Selfies und sagen: „Ich arbeite wirklich gerne.“ Was wir verschweigen: Die Sonntagabende, die sich anfühlen wie das Ende des Sommerurlaubs. Die schlaflosen Nächte, in denen wir überlegen, ob das alles so weitergehen kann. Oder soll.
Dabei fühlen sich viele Beschäftigte im Job regelmäßig unterfordert oder gar fehl am Platz. Gleichzeitig empfindet nur ein Teil ihre Arbeit als wirklich sinnvoll. Wie passt das zusammen? Vielleicht gar nicht. Vielleicht erleben wir gerade eine kollektive Selbsttäuschung.
Schon gewusst? Laut einer Resume-Now-Studie bleiben 60 Prozent der Beschäftigten in Jobs, die sie längst verlassen wollten. Zwei Drittel glauben, ein Wechsel würde ihr Wohlbefinden verbessern. Trotzdem passiert dann doch wenig. 35 Prozent fürchten einen Gehaltsverlust und machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. Viele sind schlicht unsicher, ob ein neuer Job auch wirklich passt. Und nicht wenige wissen schlicht nicht, wo sie den ersten Schritt machen sollen.
Wenn der Bauch Nein sagt – aber der Kopf Ja
Man muss dafür gar nicht lange suchen. Da ist die Projektmanagerin, die bei jedem Teammeeting betont, wie sehr sie ihre Kollegen und deren Input schätzt, aber insgeheim jeden Jobwechselartikel auf Arbeits-ABC verschlingt. Oder der IT-Spezialist, der seit Jahren über die dysfunktionalen Prozesse in seiner Abteilung flucht, aber trotzdem davon überzeugt ist, dass es „woanders auch nicht besser wäre“. Oder die Personalerin, die sich mit der Phrase „Ich mache das ja gerne“ für ihre 40-Stunden-Woche nebst Care-Arbeit rechtfertigt, obwohl sie sich selbst kaum noch im Spiegel erkennt.
Das Gefährliche daran: Wer über Jahre gegen das eigene Bauchgefühl, ja gegen das eigene ICH, lebt, zahlt einen hohen Preis. Die ständige Diskrepanz zwischen Innen und Außen kann zu chronischer Unzufriedenheit führen. Im schlimmsten Fall resultiert sie in Erschöpfung, Burnout oder depressiven Phasen. Und dann ist das noch diese Entfremdung. Während andere scheinbar mühelos ihre Berufung leben, fühlt man sich selbst wie ein Statist im falschen Film.
Wie wir den Ausstieg aus der Job-Lüge schaffen
Doch wann ist der Punkt erreicht, an dem man sich ehrlich eingestehen sollte: Das ist es nicht (mehr)? Vielleicht, wenn man sich montags regelmäßig mit Widerwillen die Schuhe anzieht. Wenn die eigene Entwicklung stagniert – fachlich und persönlich. Wenn die Vorstellung vom Jobwechsel zwar Angst macht, aber trotzdem immer wieder anklopft. Oder wenn man sich selbst sagen hört: „Ich bleibe nur wegen der vermeintlichen Sicherheit.“
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Dann ist es Zeit, genauer hinzuschauen. Eine berufliche Neuorientierung muss nicht sofort die radikale Kündigung bedeuten. Aber sie beginnt mit Selbstreflexion. Und mit der Bereitschaft, die eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Dazu gehört, eine Art persönliche Inventur zu machen:
- Was läuft gut?
- Was fehlt?
- Was würde mich wirklich erfüllen?
Unterstützung kann dabei hilfreich sein – in Form eines Coachings, durch Gespräche mit Freunden oder durch das Lesen von Erfahrungsberichten anderer, die den Schritt gewagt haben. Wichtig ist vor allem eins: den eigenen Zweifeln Raum zu geben, statt sie zu snoozen. Nicht jeder Veränderungsschritt muss perfekt geplant sein. Aber er muss Bewegung bringen. Und einen selbst wieder ins Zentrum der eigenen Geschichte rücken.
Lese-Tipp: Diese 10 Lektionen wirst du erst lernen, wenn du ohne Plan B kündigst
Denn der Satz „Ich liebe meinen Job“ darf stimmen, muss er aber nicht. Viel wichtiger ist es, sagen zu können: „Ich arbeite gerade daran, dass mein Berufsleben besser zu mir passt.“ Wer diesen Weg geht, braucht Mut. Aber vor allem braucht er eins: Ehrlichkeit mit sich selbst.