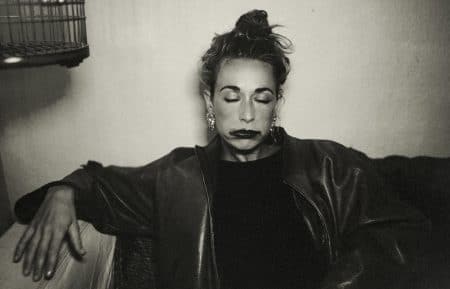Wer Karriere machen will, muss mehr leisten als die Kollegen. Früher raus, später rein, immer erreichbar, immer einsatzbereit – so lautet das Mantra, das sich viele seit dem Berufseinstieg eingeprägt haben. Wer nicht mitzieht, ist angeblich nicht ehrgeizig genug. Doch dieses Bild vom „sich-hochschuften“ bröckelt gewaltig – und die Wissenschaft liefert jetzt den endgültigen Beweis dafür.
Forscher der City University of London haben in einer umfassenden Studie die Arbeitsdaten von über 51.000 Angestellten in 36 europäischen Ländern analysiert. Dabei nahmen sie zwei Dinge genau unter die Lupe: den Einsatz, den Beschäftigte für ihren Job bringen – also Überstunden und hohes Arbeitstempo – und die Auswirkungen auf zwei zentrale Lebensbereiche: ihr Wohlbefinden und ihre Karriere.
Die Ergebnisse sind eindeutig und für viele Hustler wohl schmerzhaft entlarvend. Denn entgegen aller Annahmen bringt exzessiver Arbeitseinsatz keineswegs die erhofften Karrieresprünge. Im Gegenteil: Wer ständig Überstunden schiebt oder unter hoher Arbeitsintensität leidet, hat nicht nur mit mehr Stress und Erschöpfung zu kämpfen, sondern auch mit schlechteren Aussichten auf beruflichen Aufstieg, Sicherheit oder Anerkennung. Das ist eine klare Absage an den Mythos vom leistungsgetriebenen Aufstieg.
Arbeiten bis zum Umfallen – zahlt sich das wirklich aus?
Die Studie unterscheidet dabei zwischen zwei Arten von Arbeitseinsatz. Zum einen die klassischen Überstunden, also Arbeiten außerhalb der regulären Zeiten, oft auf Kosten von Freizeit, Schlaf oder sozialen Kontakten. Zum anderen die sogenannte Arbeitsintensität, also ein besonders hohes Arbeitstempo, permanente Deadline-Hetze oder das Gefühl, ständig unter Druck zu stehen. Beide Faktoren haben eines gemeinsam: Sie korrelieren signifikant negativ mit Gesundheit und Karriereerfolg.
Wer also glaubt, sich über Dauerstress und Selbstaufgabe besonders positiv im Unternehmen zu positionieren, sitzt einem Irrtum auf. Denn das ständige Hetzen, Nachtschichten und Wochenend-Workaholism wirken sich messbar negativ aus – nicht nur auf das psychische und körperliche Wohlbefinden, sondern auch auf die subjektive Wahrnehmung von Karriereperspektiven, Jobsicherheit und erlebter Anerkennung. Besonders drastisch ist das bei hoher Arbeitsintensität: Sie ist laut Studie der stärkste Prädiktor für negative Folgen, weit vor den klassischen Überstunden.
Lese-Tipp: Schnell, schneller, Stillstand? So gefährlich ist Dauerstress für Unternehmen
Warum Dauerstress deiner Karriere eher schadet als hilft
Die Vorstellung, man müsse sich extrem „sichtbar machen“, um durch Leistung zu glänzen, ist also nicht nur überholt, sondern gefährlich. Denn Menschen, die ständig an ihre Grenzen gehen, machen mehr Fehler, denken weniger kreativ und brauchen deutlich länger zur Regeneration. Das schlägt sich über kurz oder lang auch auf die Qualität ihrer Arbeit nieder, was wiederum negative Auswirkungen auf die Karriere hat.
Lese-Tipp: Leistungsdruck: Wenn Arbeit zum Stressfaktor wird
Trotzdem bleibt karrieregetriebenen ein kleiner Hoffnungsschimmer: Wer in seinem Job ein hohes Maß an Entscheidungsfreiheit hat – also selbst bestimmen kann, wie, wann und in welchem Tempo er arbeitet – ist laut Studie weniger stark von den negativen Auswirkungen betroffen. Diese sogenannte Discretion wirkt wie ein Puffer: Wer selbst Einfluss auf seine Arbeitsweise nehmen kann, empfindet Belastung als weniger toxisch. Und: In diesen Fällen steigen sogar die Chancen auf Anerkennung und Aufstieg. Doch auch hier gilt: Autonomie schützt nicht vor Überlastung, sie tarnt sie nur besser.
Was wirklich zählt, wenn du beruflich vorankommen willst
In der Praxis bedeutet das: Die klassische Karriereformel „mehr Einsatz gleich mehr Erfolg“ funktioniert heute nur noch bedingt – und oft gar nicht mehr. Unternehmen, die ausschließlich auf Dauerpräsenz und Hustle-Kultur setzen, laufen Gefahr, nicht nur Talente zu überlasten, sondern auch deren Potenzial zu verspielen.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Wer klug ist, fängt an umzudenken. Karriere macht man heute nicht mehr, indem man sich aufreibt, sondern indem man smart arbeitet und sich genügend Erholungszeit gönnt. Nicht der, der am längsten im Büro sitzt, kommt weiter, sondern der, der seine Energie sinnvoll einsetzt und Prioritäten setzt.
Daher gilt: Weniger schuften, mehr denken. Schluss mit dem romantisierten Selbstverschleiß. Stattdessen braucht es eine neue Definition von Engagement, eine, die nicht in Burnout, sondern in berufliche Entwicklung mündet. Denn wer immer nur ackert, hat irgendwann nichts mehr zu geben. Und das bringt niemanden weiter, weder sich selbst noch dem Unternehmen.