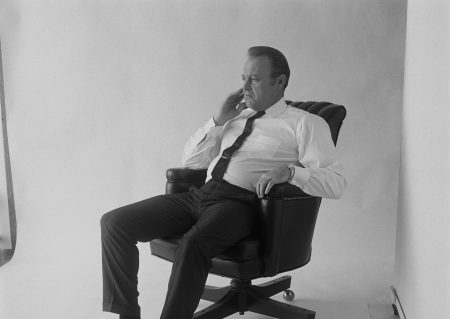Noch nie war Führung so schwer, so stressig – und so wenig attraktiv. Laut dem aktuellen „State of the Global Workplace“-Report von Gallup ist das Engagement unter Managern weltweit von 30 auf nur noch 27 Prozent gefallen. Ein scheinbar kleiner Rückgang – der in seiner Wirkung aber tiefgreifender ist, als die Zahlen zunächst vermuten lassen. Während Mitarbeitende immerhin stabil bleiben, ziehen sich die Führungskräfte spürbar zurück. Was ist da los?
Führungskräfte zwischen den Fronten
Führung war schon immer ein Spagat – jetzt ist es ein Spießrutenlauf. Die Erwartungen an Führungskräfte sind in den letzten Jahren explodiert. Tatsächlich stehen Manager heute zwischen widersprüchlichen Rollen: Sie sollen empathisch sein, aber durchsetzungsstark. Flexibilität ermöglichen, aber Leistung sichern. Nähe zeigen, aber Distanz wahren. Vertrauen schenken, aber Ergebnisse kontrollieren.
Die neue Arbeitswelt fordert alles – und bietet wenig Rückhalt. Hybride Teams, Remote-Strukturen, zunehmende Fluktuation, Fachkräftemangel, steigende Ansprüche an Sinn und Partizipation:
Führung bedeutet längst nicht mehr nur Steuern und Entscheiden. Es bedeutet Moderieren, Vermitteln, Aushalten.
Ein Blick in die Daten verdeutlicht die Schieflage: Der Rückgang des Engagements ist unter Führungskräften doppelt so stark wie unter Mitarbeitenden. Während in der Gesamtbelegschaft 21 Prozent als engagiert gelten, sind es bei Führungskräften nur 27 Prozent – Tendenz fallend. Das ist bemerkenswert, denn Führungskräfte gelten als Multiplikatoren: Sinkt ihre Motivation, wirkt sich das direkt auf die Teams aus.
Die unsichtbare Belastung
Viele Führungskräfte spüren, dass sie es niemandem recht machen können. Das Ergebnis belegt, was in Unternehmen längst spürbar ist: Manager fühlen sich überfordert, allein gelassen, emotional erschöpft. Die permanente Verfügbarkeit, die Erwartung, immer Lösungen zu haben, die Sandwich-Position zwischen Mitarbeitenden und Geschäftsführung – all das zehrt an der Motivation und an der Bindung.
Besonders bitter: Die Abkehr beginnt nicht mit einer Kündigung, sondern innerlich. Führungskräfte, die sich emotional abkoppeln, bleiben formal im Job – aber ziehen sich mental zurück. Das ist gefährlich, weil es das Team direkt mittrifft. Wenn die Führung schwächelt, leidet die gesamte Organisation.
Doch das Problem liegt tiefer. Die Krise der Führung ist auch eine Krise der Strukturen. Viele Unternehmen haben zwar flexible Arbeitsmodelle eingeführt – Homeoffice, hybride Teams, asynchrone Zusammenarbeit. Aber die Führungsstrukturen blieben oft die alten. Verantwortung wurde weitergegeben, ohne neue Instrumente der Steuerung, Kommunikation und Bindung zu schaffen. Führungskräfte stehen zwischen gewachsenen Erwartungen und geschrumpften Einflussmöglichkeiten. Die Organisation entzieht ihnen den Raum, gleichzeitig wächst der Anspruch, diesen Raum trotzdem zu füllen.
Führen ohne Fundament
Der Rückzug der Führungskräfte ist auch eine Folge mangelnder systemischer Unterstützung. Viele Unternehmen haben die Rahmenbedingungen der Führung in hybriden und flexiblen Modellen nie klar definiert. Plötzlich müssen Manager Konflikte aus der Distanz lösen, Motivation über Bildschirme erzeugen, Zugehörigkeit und Bindung ohne gemeinsame Räume stiften.
Was früher der Flur, das Büro, das gemeinsame Meeting geleistet haben, fällt jetzt weg – und es gibt keinen Ersatz. Führung ohne physische Nähe braucht neue Werkzeuge, neue Rituale, neue Kommunikationsräume. Doch genau diese wurden vielerorts nicht geschaffen. Stattdessen wird Führung an individuelle Fähigkeiten delegiert – und damit überladen.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Hinzu kommt ein kulturelles Tabu: Überforderung zuzugeben gilt für viele Führungskräfte als Schwäche. Wer Verantwortung trägt, muss durchhalten – so die unausgesprochene Erwartung. Psychische Belastung, emotionale Erschöpfung, Zweifel? Kein Thema für die Chefetage. Führungskräfte kämpfen mit ihren Sorgen eher im Verborgenen, weil sie Angst haben, als ungeeignet für die Position zu gelten. Dabei bräuchten gerade sie sichere Räume, um ihre Belastung zu reflektieren.
Führung braucht auch Fürsorge
Die wenigsten Unternehmen haben bislang Strukturen etabliert, die Führungskräfte entlasten. Es gehe nicht um mehr Resilienz-Tools, sondern um mehr Klarheit: Klare Erwartungen, klare Zuständigkeiten, klare Unterstützung. Dazu gehöre auch: Coaching, Austauschformate, Führungstandems, Supervision.
Doch damit allein ist es nicht getan. „Es braucht auch strukturelle Entlastung: realistische Zielvorgaben, Priorisierung, eine klare Abgrenzung zwischen Führung und operativen Aufgaben. Führungskräfte müssen sich auf ihre Kernrolle konzentrieren können – und dürfen nicht als Lückenbüßer für alle Systemfehler oder gar Personalmangel herhalten. Ebenso wichtig: Peer-Formate, in denen Führungskräfte sich untereinander austauschen können, sowie ein Recht auf Nichterreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit.
Führung ist und bleibt ein Beziehungsgeschäft – egal, ob remote oder vor Ort. Führungskräfte brauchen Gelegenheiten, in denen sie selbst Unterstützung, Vertrauen und Rückhalt erfahren. Das können Peer-Meetings, Supervision, Coaching oder kollegiale Beratung sein. Wer Führungskräfte allein lässt, verliert nicht nur sie – sondern auch die Teams, die an ihnen hängen.