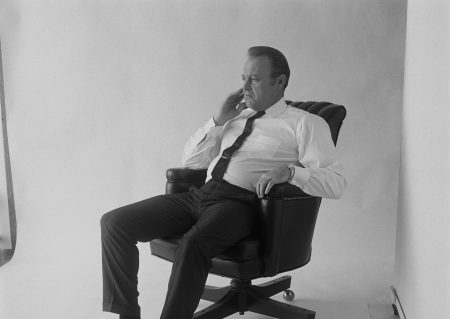Es klingt wie ein Naturgesetz der Ökonomie: Wer nicht wächst, stirb. Wachstum gilt als Gradmesser von Erfolg, als Legitimation unternehmerischer Existenz. Vom Tech-Start-up bis zum globalen Konzern orientieren sich Geschäftsmodelle, Strategien und Kommunikation am Primat des Skalierens. Was sich nicht multipliziert, hat keinen Bestand, so die implizite Drohung.
Doch unter der Oberfläche dieses wirtschaftlichen Dogmas lauert eine Leerstelle. Denn was in Quartalszahlen, Investoren-Decks und Businessplänen selten vorkommt, ist das Subjekt des wirtschaftlichen Handelns: der Mensch.
Die Entkörperlichung der Arbeit
Moderne Organisationen sind bemerkenswert gut darin geworden, den Menschen aus ihrem Selbstverständnis herauszurechnen. Die Rede ist von „Human Capital“, von „Resources“, von „FTEs“ – Full-Time Equivalents. Es ist die Sprache der Berechenbarkeit und der Produktivität. Was zählt, ist Verfügbarkeit und Output.
Dabei ist diese Entkörperlichung der Arbeit kein Zufallsprodukt. Sie ist Resultat einer Managementlogik, die auf Optimierung abzielt und dabei zunehmend das ausklammert, was sich nicht messen lässt: Motivation, Zugehörigkeit, Sinn. Das Paradoxe daran: Gerade diese „weichen Faktoren“ sind es, die in volatilen Märkten Stabilität schaffen.
Die qualitative Krise der Arbeit
Zahlreiche Studien legen nahe, dass wir inmitten einer qualitativen Krise der Arbeit stehen. Während Unternehmen auf Fachkräftemangel und Innovationsdruck verweisen, sinkt die emotionale Bindung der Mitarbeitenden Jahr für Jahr. Nicht, weil Menschen plötzlich arbeitsfaul wären, sondern weil die strukturellen Rahmenbedingungen ihrer Arbeit nicht mehr zu den realen Bedürfnissen passen.
Flexibilität wird erwartet, aber dennoch kaum ermöglicht. Selbstverantwortung gefordert, aber natürlich unter permanenter Kontrolle. Aktive Beteiligung suggeriert, aber kommen dann Impulse, verhallen sie im Nichts. Der vielbeschworene „Cultural Fit“ bleibt Schein, solange Kultur nicht mehr ist als ein austauschbares Wort.
Dabei sind die Folgen längst bekannt: Innovationskraft stockt, Loyalität zum Arbeitgeber bröckelt, innere Kündigungen häuft sich. Unternehmen werden so Schritt für Schritt immer träger. Und während diese strukturelle Erosion vielerorts noch still vor sich hin arbeitet, wird sie in manchen Fällen abrupt sichtbar.
So etwa bei Microsoft, das im hiesigen Somer die größte Kündigungswelle seit Jahren ankündigte. Laut heise.de sollen bis zu 9?100 Mitarbeitende gehen – rund vier Prozent der globalen Belegschaft. Besonders betroffen sind Abteilungen, die noch vor Kurzem als zukunftsweisend galten und in die Microsoft seit der ersten Xbox massiv investiert hat: die Gaming-Sparte. Die offizielle Begründung: man wolle das Unternehmen „für den Erfolg in einem dynamischen Markt positionieren“.
Doch was bedeutet Erfolg, wenn er auf dem strategischen Austausch von Belegschaften basiert? Wenn Wachstumsversprechen in immer kürzeren Zyklen eingelöst werden müssen, notfalls durch harte Peronalschnitte? Solche Entscheidungen legen offen, wie sehr der Mensch in der Logik ökonomischer Skalierung zur austauschbaren Ressource wird. Und wie wenig Raum für Beziehung, Vertrauen und Kontinuität in einem System bleibt, das auf ständige Beschleunigung setzt.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Jenseits der Zahlen: eine andere Form von Wachstum
Was also müsste sich ändern? Die einfache Antwort wäre: Führung. Doch auch das greift zu kurz. Denn Führung ist immer auch ein Spiegel der Unternhemenskultur und des Managements, ihres Selbstbilds und ihrer ökonomischen Prämissen. Wirklich zukunftsfähig wird Arbeit nur dann, wenn Unternehmen ihr Wachstumsversprechen neu verhandeln, nicht gegen den Menschen, sondern mit ihm.
Das bedeutet nicht den Abschied von Effizienz, sondern eine Erweiterung ihrer Definition. Produktivität muss nicht länger im Widerspruch zur psychologischen Sicherheit der Beschäftigten stehen. Wertschöpfung kann sehr wohl auf Sinn und Stabilität aufbauen. Es erfordert nur ein anderes Verständnis von Erfolg – eines, das sich nicht allein an Quartalszahlen messen lässt.