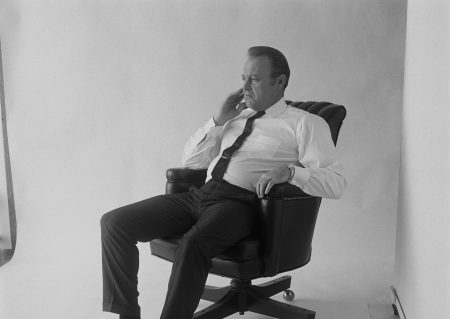Inmitten politischer Debatten über Fachkräftemangel und stagnierendes Wirtschaftswachstum rückt ein altbekanntes Thema erneut in den Fokus: die Arbeitszeit. Während wirtschaftsnahe Stimmen mehr Flexibilität und längere Arbeitszeiten fordern, zeigen aktuelle Daten des DGB-Index Gute Arbeit, dass Überstunden für viele Beschäftigte zur Belastung geworden sind – sowohl psychisch als auch ökonomisch.
Mehr als jede zweite Überstunde bleibt unvergütet
Die Auswertung der Jahre 2020 bis 2024 offenbart: Über die Hälfte aller Überstunden in Deutschland wird nicht bezahlt. Für das Jahr 2024 entspricht das einem Arbeitsvolumen von rund 638 Millionen unbezahlten Stunden – ein strukturelles Ungleichgewicht, das vor allem auf Kosten der Beschäftigten geht.
Trotz eines Rückgangs des Gesamtüberstundenvolumens bleibt die Zahl mit rund 1,2 Milliarden Stunden jährlich auf hohem Niveau. Umgerechnet entspricht das der Arbeitszeit von über 750.000 Vollzeitstellen.
Homeoffice: Mehr Flexibilität – mehr Überstunden
Der Wandel hin zum Homeoffice, beschleunigt durch die Corona-Pandemie, hat auch Auswirkungen auf die Verteilung der Überstunden. 52 Prozent der Beschäftigten im Homeoffice leisten regelmäßig Überstunden – im Vergleich zu 31 Prozent bei denjenigen, die überwiegend Präsenzarbeit leisten. Besonders auffällig: 30 Prozent der Homeoffice-Nutzer überschreiten die Grenze von fünf Überstunden pro Woche.
Überstunden vertiefen soziale Ungleichheiten
Die Studie verweist zudem auf den Zusammenhang zwischen Überstunden und gesellschaftlicher Ungleichheit:
- Gender Care Gap: Fehlende Betreuungsangebote verschärfen die Last gerade für Frauen, die oft zusätzlich zur Arbeit unbezahlte Care-Arbeit leisten.
- Qualifikationsniveau: Je höher der Anspruch der Tätigkeit, desto häufiger treten Überstunden auf. In akademisch geprägten Berufen leisten 35 Prozent der Beschäftigten mehr als fünf Überstunden pro Woche.
Folgen für Gesundheit und Arbeitsqualität
Mit steigendem Arbeitsvolumen sinkt nicht nur die Zufriedenheit mit der Work-Life-Balance, sondern auch die Qualität der Arbeit. Jeder Dritte mit über fünf Überstunden pro Woche gibt an, regelmäßig Abstriche bei der Arbeitsausführung machen zu müssen.
Besonders alarmierend: 10,1 Prozent der Vollzeitbeschäftigten arbeiten durch Überstunden mehr als 48 Stunden pro Woche – eine Schwelle, die laut Arbeitszeitgesetz als gesundheitsgefährdend gilt. Die Risiken reichen von Schlafstörungen über Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zu steigender Unfallgefahr.
Strukturelle Ursachen: Organisation und Arbeitsbelastung
Ein zentraler Befund der Analyse: Überstunden sind keine individuelle Entscheidung, sondern häufig Ausdruck mangelhafter Arbeitsorganisation und hoher Verdichtung. Beschäftigte, die unter Zeitdruck stehen oder regelmäßig unterbrochen werden, leisten deutlich mehr Überstunden. Auch widersprüchliche Anforderungen verstärken dieses Muster.
Auch beim Thema Überstunden gilt: Weniger ist mehr
Der DGB fordert daher ein Umdenken in der Arbeitszeitpolitik: Statt auf längere Arbeitszeiten zu setzen, sollte die Arbeitsorganisation verbessert, Care-Infrastruktur ausgebaut und der rechtliche Schutz vor unbezahlten Überstunden gestärkt werden.
Der Arbeitstag
Welche Jobs haben Zukunft? Wo knirscht’s zwischen Boomern und Gen Z? Wie verändern KI und Fachkräftemangel unser Berufsleben? „Der Arbeitstag“ ist der Newsletter mit allem, was die moderne Arbeitswelt bewegt. Klar, kompakt und direkt ins Postfach.
Denn klar ist: Längere Arbeitstage sind kein Allheilmittel gegen den Fachkräftemangel, sondern verschärfen ihn nur. Denn Überstunden gefährden langfristig die Gesundheit der Beschäftigten und die Qualität der Arbeit.